Das Rätsel der 17 Kamele – Tiefen und Untiefen
1. Das Rätsel der der „17 K“ ist einzigartig. Das zeigt schon seine Architektur: Sie besteht aus zwei Teilen, einem sichtbaren und einem unsichtbaren.
Der erste Teil ist das, was auf der Bühne der Erbteilung zwischen den Söhnen und dem Derwisch geschieht: es ist der für mich unwiderlegbare Beweis, dass 17 Kamele auf 3 Söhne aufgeteilt werden können, ohne dass ein Tier getötet wird. Das Rätsel selbst präsentiert also seine Lösung! Das muss der Rätseldeuter erkennen!
Und das erkennen eigenartigerweise fast alle Analysten nicht: Sie kommen zu dem Schluss „das Rätsel ist unlösbar, geht mathematisch nicht“. Das Wunder der plötzlichen Überwindung der Primzahl wird überhaupt nicht gewürdigt.
Kann es sein, dass diese Analysten die Erbteilung für „irgendwie unwirksam“ halten? Das wäre allerdings lebensfremd. Die Söhne haben gesehen, dass die 17 Tiere des Vaters nach seinen Erbquoten von dem Derwisch verteilt wurden; ob dies auf Basis 17 oder 18 geschah, war ihnen egal.
Jedenfalls hat noch keiner der Deuter gesagt, was eigentlich an dem Rätsel mathematisch nicht gehen soll. Dass die unmittelbare Teilung der Primzahl 17 nicht geht, ist unbestritten. Dass die mittelbare Teilung der Primzahl, die es schon immer gab, nicht gehe, hat indessen noch niemand behauptet.
In dem zweiten Teil des Rätsels geht es nicht mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“. Wie kommt die Lösung zustande? Die Aufgabe der Deuter: Eine Geschichte – „heute Erzählung“ – zu erfinden, die zu der Lösung führt. Auch hier natürlich passen die Analysten. Nur wenige sagen: „Es muss irgendwie gehen“.
Zusammenfassend: Die Lösung des Rätsels der „17 K“ ist im Grunde trivial:
• wenn die unmittelbare Aufteilung der 17 Kamele auf drei Söhne ohne Tötung eines Tieres nicht geht,
• die Aufteilung von 18 Kamelen auf vier Personen (Söhne und Derwisch) ohne Tötung eines Tieres aber sehr wohl geht,
• dann ist klar: Das Rätsel ist lösbar.
2. Für das Scheitern der Analysten gibt es nach meiner Meinung zwei Erklärungen:
• Erstens: Sie steigen an der falschen Stelle in das Rätsel ein, nämlich bei den Erbquoten, und fangen an zu rechnen. Das führt in die Irre. Nicht die Erbquoten sind der Angelpunkt des Rätsels, es ist vielmehr die Strategie des Vaters: die 18 als „Königsweg“ und damit das zurückbehaltene 1/18! Denn der Vater hat nur 17 von 18 Tieren verteilt!
• Zweitens: Das Rätsel wird beherrscht von zwei Welten: der „17er Welt“, in der die Söhne und die Analysten leben; der „18er Welt“ des Vaters und seiner Strategie der Teilung von 18 Kamelen, eine Teilung, die der Vater aber vor seinen Söhnen geheim hält. Er legt nur die Erbteile von 17/18 offen. Er verschweigt dagegen die Notwendigkeit des 18. Kamels, das Zurückbehaltene 1/18 und die eigentlichen Erbanteile (Quanten) 9/18 – 6/18 – 2/18.
Fazit: Die Söhne/Analysten glauben, 17 Kamele bei der Teilung zu sehen, während in Wahrheit 17 von 18 Kamelen verteilt werden.
Die Teilungsgleichung lautet deshalb:
9/18 + 6/18 + 2/18 + 1/18 = 18/18 = 1
3. Statt den Weg der „18“ zu wählen, hätte der Vater auch seine 17 Tiere – bei Teilung der 17 durch sich selbst – unmittelbar ganzzahlig teilen können mit dem gleichen Ergebnis (9-6-2)
Die Teilungsgleichung hätte gelautet:
9/17 + 6/17 + 2/17 = 17/17 = 1
Der Vater wollte diesen Weg – den Quantenweg – aber nicht, weil er so seine Söhne nicht herausfordern und seine Strategie nicht hätte tarnen können. Und es hätte das Rätsel der „17 K“ nicht gegeben.
4. Die Lösung des Rätsels wird getragen von der mittelbaren Teilbarkeit der Primzahl über eine höhere Nicht-Primzahl: diese mittelbare Teilbarkeit gab es schon immer, nur wird sie allgemein nicht erkannt. Das heißt aber: entgegen der allgemeinen Meinung gibt es keine unteilbare Primzahl. Unmöglich ist nur die unmittelbare Teilung.
Die Leugner der Lösbarkeit des Rätsels argumentieren z.B. so: Wenn ich nur 17 Kamele habe, kann ich nicht 18 Kamele teilen. Das klingt klug, ist es aber nicht. Schon immer nutzen Menschen Mittel, die sie nicht haben. Das nennt man Kredit.
Mit dieser Möglichkeit der mittelbaren Teilbarkeit jeder Primzahl wird nicht die Mathematik angezweifelt: Diese ist unfehlbar. Angezweifelt wird der Blick des Menschen auf die Mathematik: Und der ist fehlbar.
Interessant ist die Frage: Was ist eigentlich, wenn eine Lösung „mathematisch nicht geht“, aber das zugrunde liegende Problem beseitigt? „Ein Wunder“?
5. Ein denkwürdiger Aspekt des Rätsels ist philosophischer Natur: Aus einer unlösbaren Aufgabe kann zuweilen – durch geringfügige Veränderung der Aufgabe – eine lösbare Aufgabe gemacht werden. Bei den „17 K“ reichte die Hinzufügung eines Kamels! Berühmtestes Beispiel der Geschichte dürfte die Lösung des Problems der“ Stimmung“ oder „Temperatur“ in der Musik gewesen sein. Die Menschheit hat hierfür seit Pythagoras über 2000 Jahre gebraucht.
6. Das Rätsel fordert den Blick auf das heraus, was hinter den Zahlen und ihren Bewegungen steht: Ein faszinierendes Grenzgebiet zwischen Mathematik und Philosophie,
ein „a priori-Feld“.
Die Zahl als „Quantenbündel“. Bei ihrer Teilung erlischt die Zahl und ihre kleinsten Bausteine (Quanten) werden frei und beginnen ein neues Leben (z.B. teilen sich weiter oder verbinden sich mit anderen gleichartigen Quanten).
Pure Spekulation? Oder eine Idee? Oder eine Denknotwendigkeit, wo die Vorstellungskraft unseres Gehirns versagt?
Vorstellbar ist folgendes Denkgerüst: Die Quanten einer Zahl ergeben sich aus der Teilung der Zahl durch sich selbst (Quantisierung), die immer möglich ist, auch bei Primzahlen, die hierdurch mit den Nicht-Primzahlen verbunden sind. Der Quotient der Teilung ist „Eins“ (1), die die Lebenswirklichkeit (hier eine Anzahl Kamele) wiedergibt – „Realquanten“ -. Teilt man die „Eins“ wiederum durch die Zahl, so ergeben sich spiegelbildlich die „Anteilsquanten“, die sich zu 1 addieren. Sie beherrschen das Rätsel.
Das Rätsel der „17 K“ ist geradezu ein Modell für die Quantensicht, stellt es doch die beiden relevanten Quantenreihen klar gegenüber:
- die Reihe der 17 bzw. 18 Kamele (Realquanten),
- die Reihe der 17 bzw. 18 Achtzehntel (Anteilsquanten).
7. Die Rätsellösung zeigt, dass unsere „Bruchrechnung“ als Teilungsrechnung (die Erbquoten 1/2-1/3-1/9) naturgemäß bei der unmittelbaren Teilung von Primzahlen versagen muss.
Die „Quantenrechnung“ hingegen kann auch Primzahlen ‚knacken‘: Auf der „Quantenebene“ gibt es nichts mehr zu teilen, es gibt nur noch Addition und Subtraktion.
8. Quantensicht und Quantenrechnung eröffnen einen klareren Blick auf das Zustandekommen menschlicher Entscheidungen: Sie zeigen die kleinsten Bausteine eines Lebenssachverhalts und damit die „Optionen“, die wir wirklich haben, wir, die wir viel zu viel in „Alternativen“ oder gar „alternativlos“ denken.
Am Beispiel des Rätsels: Aus den 17/Achtzehnteln der Lösung sind nach meiner Rechnung mindestens 42 unterschiedliche Erbteilungen für die drei Söhne zu „Optionen“ kombinierbar. Nach der Bruchrechnung gibt es dagegen nur eine einzige Option: Die Erbteile, die der Vater bestimmt hat.
Fazit: Wir sollten mehr in Quanten und Optionen als in Brüchen und Alternativen denken und kommunizieren. Die Erkenntnis sollte von den kleinsten Bausteinen zu den Handlungsoptionen und von diesen zu Entscheidungen fortschreiten.
Vielleicht sind es ja diese Quanten, die uns die geheimnisvolle Tiefe des Rätsels der 17 Kamele spüren lassen.
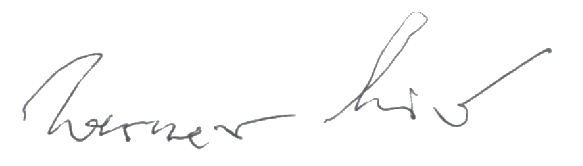

Schreibe einen Kommentar